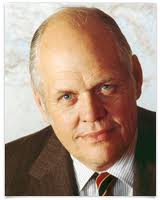Der Informationsfluss wächst immer schneller. Die Halbwertszeit von Daten wird immer kürzer. Was heute für den Entscheider relevant und zeitgerecht ist, kann morgen schon veraltet und uninteressant sein. Gleichzeitig nimmt die Datenmenge dramatisch zu.
Angesichts dieser Herausforderungen hat sich IBM auf der diesjährigen ECM Anwendertagung in Frankfurt am Main vertieft mit der Zukunft von Enterprise Content Management (ECM) in Unternehmen auseinandergesetzt. Ziel ist es, Unternehmen zu helfen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden und zu jeder Zeit direkten Zugriff auf die entscheidenden Daten zu gewährleisten. Dabei geht der Trend nach Ansicht von Big Blue stark in Richtung Social Software Komponenten als Werkzeuge der Kommunikation und des Zusammenarbeitens.
„Die Mauern des traditionellen Unternehmens werden fallen!“ Verbunden mit dem Bild eines Mauerspechts beim Fall der Berliner Mauer vor über 20 Jahren setzte Stefan Pfeiffer, Market Segment Manager Social Business & Collaboration Solutions der IBM Deutschland GmbH (mögliches Bild), in seiner Keynote der Anwendertagung ein interessantes Statement.
Dabei sieht der für das Thema Social Business zuständige Evangelist vier Grundpfeiler eines sich anbahnenden Wandels:
– Neue Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle in Verbindung mit Globalisierung verändern die Arbeitswelt grundlegend.
– Smartphones und Tablet PCs werden immer mehr nicht nur privat, sondern auch beruflich genutzt.
– Der Einsatz von Social Media setzt sich in der Politik, privat und auch im Business immer stärker durch.
– Nicht zuletzt verändert die Wolke des Internets, die Cloud, die IT-Landschaften dramatisch. Die Cloud ist – im privaten Umfeld bereits da – und kommt nun in die berufliche Welt.
Diese Trends, so Pfeiffer, verstärken sich gegenseitig so stark, dass man von einer neuen IT-Situation in den Unternehmen sprechen kann. Dabei werden nach Angaben der Marktforscher von IDC die Bereiche Cloud Services, Mobile Computing und Social Networking bereits im laufenden Jahr 2011 eine gewisse Marktreife erreichen und dann zu einer neuen Mainstream-Plattform zusammenlaufen.
Home Office – Mobile Office
Beim Thema Arbeitsplatz der Zukunft wird bei den „Weiße-Kragen-Berufen“ das Home Office, oder besser gesagt das Mobile Office, immer wichtiger. Und das, obwohl sich noch viele verantwortliche Manager in den Unternehmen gegen diesen Trend aus Gründen eines möglichen Machtverlustes durch unmittelbare Kontrolle wehren.
So gaben in einer Untersuchung das Fachmagazins CIO 22,8 Prozent der Befragten zu Protokoll, dass in ihrem Unternehmen mobiles oder „remote-basiertes Arbeiten“ gar nicht erlaubt sei.
Weitere 16,8 Prozent erklärten, das sei nur „in Ausnahmefällen“ möglich, 28 Prozent wissen nicht, um was es geht. Nur eine kleine Minderheit von gerade einmal 9,4 Prozent ermutigt alle Mitarbeiter darin, von unterwegs, zu Hause oder remote zu arbeiten.
Siegeszug der mobilen Geräte
Gerätetechnisch spielen dabei iPhone und iPad von Apple sowie die verwandten Android-Geräte von Google eine große Rolle. Was Bill Gates 2001 auf einer Computershow in Las Vegas noch vergeblich versuchte, ist Marketingguru Steve Jobs 2010 mit seinen persönlichen „Touchscreen-Maschinen“ gelungen.
Der Erfolg der Apple Tablets läutet nach Ansicht des IBM-Managers eine neue Generation von Geräten ein. Immer mehr werden auch professionelle B2B-Lösungen in App Stores verfügbar. Das ist auch eine starke Veränderung in der Art und Weise, wie Software in Unternehmen verteilt wird (Distribution).
Bei dem Mensch-Maschine-Kontakt ist das Zeitalter der Maus vorbei, wir streicheln nun unsere Mobilegeräte, sagte Pfeiffer in einem Gespräch mit DOK auf der Veranstaltung in Frankfurt. Der Zugang zu vielen Ebenen des „Social Networking“ erfolgt immer häufiger über mobile Geräte.
Zusammenarbeiten über den „Aktivitäten-Wall“
In einer Unternehmenswelt, in der Komponenten des „Social Workplace“ verstärkt eine Rolle spielen, geht der Trend vom E-Mail und dokumenten-orientiertem Arbeiten mehr zu Komponenten wie Zusammenarbeit in Echtzeit, zu Instant Messaging, Unified Telephony und Videokonferenzen.
Besonders wichtig scheinen für Pfeiffer „Activity Streams“ à la Facebook-Walls an den Social Workplaces mit mehr offenen Teilen von Informationen zu sein. Der Trend geht weg vom Zeitalter des Herrschaftswissens hin zum Zeitalter des Teilens (Sharings). Arbeit in Netzwerken und Gemeinden sowie das Bereitstellen von Informationen im Kontext durch Analysen stehen im Vordergrund.
In einem Artikel von „Zeit Online“ war zu lesen, dass das „Facebook-Prinzip“ ins Büro einziehe. Wissen, was die Kollegen tun, sei in der heutigen Bürowelt das A und O. Anbieter wie IBM, Salesforce und Xing übernehmen Facebook-Komponenten unter dem Motto „Enterprise 2.0“ in ihre Software. Stefan Pfeiffer findet dafür den Ausdruck „Social Business“ treffender.
Es gilt zu beachten, dass vor diesem Trend die Fluten der Daten schon sehr groß war. Doch nun wird die Menge an Content noch mehr. E-Mail, Dateien, Papier, Tweets, Foreneinträge, Blogs, Wikis, Videos, Chats sorgen für weiteres Wachstum und neue Vielfalt. Zusätzlich verlangen die Regeln für Governance, Risk Management & Compliance, dass auch die neuen Inhalte archiviert werden und somit weiteren Speicherraum benötigen.
Dabei rückt durch das Social Web der Kunde stärker in den Mittelpunkt der Geschäftsprozesse. Marketing und Werbung wandeln sich vom Schaufenster zur Kommunikationsplattform. Geschäftsvorgänge starten im Social Web und müssen per Case Management bearbeitet werden. Content und Case Management werden somit „sozial“.
Als Folge werden die Integration von Real Time Collaboration und Social Software Funktionen in das ECM Portfolio zur Pflicht. Den richtigen Inhalt zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Zusammenhang zur Verfügung zu haben, heißt die Devise. Content Analytics bedeutet somit auch Social Analytics, so Pfeiffer.
Veränderungen im ECM-Portfolio der IBM
Auf diese Herausforderungen reagiert IBM mit konkreten Veränderungen in seinem ECM-Portfolio, das weitgehend auf Komponenten von FileNet P8 und auf Collaboration-Technologien der IBM basiert:
– Integration von Social Komponenten in Case Manager.
– Quickr als Frontend und Team Collaboration-Plattform zu Content Manager und FileNet.
– Quickr-Konnektoren zur Integration auf dem Desktop und in Office-Pakete.
– Zugriff auf ECM Content aus IT-Programmen wie Lotus Notes, Sametime, Symphony, Windows Explorer und Microsoft Office.
– Integration von ECM in das IBM Portal WebSphere.
Dazu einige Hintergrundinformationen zu den genannten Komponenten:
FileNet
Das Flaggschiff der IBM ECM-Strategie ist FileNet. Das 1982 im kalifornischen Costa Mesa gegründete Unternehmen war ursprünglich Hard- und Softwarehersteller im Umfeld optischer Speichertechnologien. Mit seiner jüngsten Produktlinie FileNet P8 spielt es eine wichtige Rolle im Bereich Enterprise Content Management.
Das Unternehmen erweiterte im Laufe der Zeit mehrmals seine strategische Ausrichtung, so beispielsweise Anfang der 1990er Jahr von der Hardware zur Software im Bereich des Dokumentenmanagements (DMS). Im August 2006 wurde FileNet von IBM zur Verstärkung seiner Information on Demand (IoD) Initiative übernommen.
IBMs aktuelles ECM-Portfolio ruht auf den drei wesentlichen Funktionspfeilern Content, Process und Compliance. Diese Funktionalitäten sollen Unternehmen eine einfache Bereitstellung von Inhalten, eine schnellere Entscheidungsfindung und die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ermöglichen.
Case Management
Bei der Case Management-Strategie von IBM werden Informationen, Prozesse und Menschen vernetzt, um eine umfassende Übersicht über einen Fall zu erstellen. Neben der Verwaltung von Content und Prozessen beruht das Konzept auf erweiterten Analysefunktionen, Geschäftsregeln, Teamarbeit und Social Software, wodurch bessere, optimierte Fallergebnisse erzielt werden sollen.
Mit dem verbesserten Paket Advanced Case Management wird der Bereich Fallmanagement weiter ausgedehnt, indem Funktionalitäten zur effizienten Abwicklung integriert und durch intelligentere Prozesse bessere Ergebnisse erreicht werden. Spezielle Bereiche wie Kundenanfragen, Darlehensanträge, komplizierte branchenspezifische Zusammenhänge oder regulatorische Verfahren können so besser genutzt werden. Durch die Automatisierung der richtigen Prozesse, Anwendung der passenden Analyse und Einbeziehung der erforderlichen Fachleute sollen die besten Fallergebnisse ermöglicht werden. Dabei gibt es verschiedene Konzepte für unterschiedliche Branchen.
Lotus Notes, Connections und Quickr
Nicht zuletzt muss noch IBMs Lotus Notes Plattform im Rahmen der geschilderten Veränderungen erwähnt werden. Die Software Familie wurde ursprüngliche 1984 von der Iris Associates als dokumenten-orientiertes Datenbanksystem (daher der Name „Notizen“) mit späterer starker E-Mail Anbindung entwickelt. Zunächst unter dem Dach der Lotus Development Corp. kam Lotus Notes 1996 in das Software-Portfolio der IBM. Es wird seither von Big Blue mit dem Serverteil Lotus Domino und dem Client Lotus Notes als Groupware und Kommunikations-Plattform gegen Outlook und Exchange von Microsoft positioniert.
Lotus Notes bleibt ein Flaggschiffprodukt der IBM. Ergänzend, aber auch komplett unabhängig von Notes können Komponenten wie IBM Connections, ein „Facebook für das Unternehmen“ und Quickr, eine dokumentenorientierte Team Collaboration-Plattform, eingesetzt werden. Die auf Web 2.0 Funktionen basierende Software wurde gezielt entwickelt, um die gemeinsame Nutzung von Geschäftsinhalten und die Online-Zusammenarbeit zwischen Teams zu vereinfachen.
Die Komponente Sametime ist in diesem Zusammenhang das entsprechende Angebot für „Instant Messaging“, Telefonie und Konferenzschaltungen. Diese Lösungen laufen auch im Zusammenspiel mit Microsoft Office, Outlook oder auch Sharepoint.
Lotus Symphony, ein frei verfügbares Produkt, entspricht mit den Elementen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation der Bürosoftware Office von Microsoft.
Das gesamte Collaboration Portfolio wird in erster Linie von IBM selbst und seinen Partnern genutzt und im Rahmen von Lösungspaketen auch den Kunden angeboten.